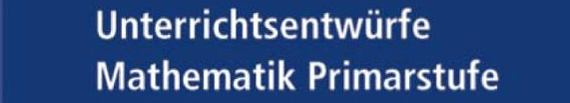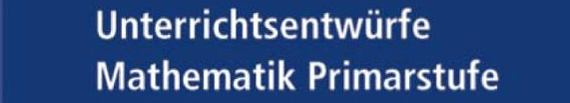>> Home
>> MPS-Reihe
>> Uni-Homepage
>> Kontakt |
Probekapitel
Einen gründlichen Einblick in Aufbau und Zielsetzung des Buches Unterrichtsentwürfe Mathematik Primarstufe vermittelt das nachfolgende
Original-Einleitungskapitel:
Einleitung
Der vorliegende Band ist in erster Linie für Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter sowie für Studierende des Lehramts für die Primarstufe geschrieben, die sich im Rahmen des
Referendariats oder im Rahmen eines Praktikums im Studium gründlicher mit der Planung und Realisierung von Unterricht befassen. Jedoch ist das Buch auch
eine gute Handreichung für erfahrene Lehrer sowie Dozenten in Studienseminaren und Universitäten, insbesondere wenn die eigene Ausbildung vor der Zeit der
Bildungsstandards erfolgte. Denn zum einen wird ein Bild des gegenwärtigen Mathematikunterrichts mit den hieraus resultierenden Anforderungen vermittelt,
zum anderen geben die aufgeführten Unterrichtsentwürfe wertvolle Anregungen für die praktische Umsetzung dieser Anforderungen im Unterricht.
Unterrichtsentwürfe - kein überflüssiger Luxus!
Die erste Phase des Lehramtsstudiums bis zum ersten Staatsexamen ist aktuell durch einen recht hohen theoretischen und einen recht geringen
praktischen Anteil gekennzeichnet. Die Vermittlung von fachlichen und didaktischen Kenntnissen steht eindeutig im Vordergrund und schafft die
notwendige Basis für didaktisch sinnvolles Handeln. So gibt es mittlerweile eine Fülle von Anregungen beispielsweise für produktive Lern- und
Übungsformate wie z. B. Zahlenmauern (vgl. Krauthausen 1995, Scherer 1997a), Zahlenketten (vgl. Scherer 2001, Scherer & Selter 1996, Selter &
Scherer 1996, Verboom 1999), Zahlenmuster (vgl. Verboom 1998), Zahlentreppen (vgl. Schwätzer 2001) oder Einmaleinszüge (vgl. Abschnitt 4.12).
Im günstigen Fall gehen die Studierenden also mit einer Fülle didaktisch fruchtbarer Ideen in den Unterricht. Dies stellt jedoch nur eine notwendige,
aber keine hinreichende Bedingung für das Gelingen von Unterricht dar, weil das Unterrichtsgeschehen sehr komplex ist und neben didaktischen Aspekten
eine Vielzahl weiterer Faktoren miteinfließt. Auch die schönste didaktische Idee kann im Unterricht scheitern, wenn solche Einflussfaktoren nicht beachtet
werden. So kann es etwa passieren, dass die Schüler resignieren, wenn man die Lernvoraussetzungen der Schüler missachtet, z. B. weil sie das zu Entdeckende
bereits in einem anderen Zusammenhang (evtl. in einer früheren Klassenstufe) kennengelernt haben oder im umgekehrten Fall, wenn die notwendigen Voraussetzungen
für die Erarbeitung bei den Schülern nicht gegeben sind. Die angehenden Lehrer müssen folglich ein Bewusstsein für die zahlreichen Faktoren entwickeln, die das
Unterrichtsgeschehen beeinflussen können. Die in der zweiten Ausbildungsphase fest verankerten Unterrichtsbesuche in Verbindung mit den zugehörigen schriftlichen
Unterrichtsentwürfen leisten hierzu einen wesentlichen Beitrag. Sie stellen jedoch ganz neue Anforderungen an die angehenden Lehrer und versetzen Lehramtsanwärter
zuweilen in Angst und Panik. Dabei mangelt es nicht wie oben beschrieben an didaktisch wertvollen Ideen. Auch werden viele Einflussfaktoren des Unterrichts
bei der mündlichen Planung intuitiv berücksichtigt. Der Knackpunkt liegt vielmehr in der Strukturierung und Ordnung dieser Ideen, um aus ihnen ein in sich
schlüssiges Gesamtkonzept zu erstellen. Genau hierin liegt jedoch der Sinn und Zweck des Schreibens von Unterrichtsentwürfen, die zu diesem Strukturierungsprozess
zwingen. Ihre Funktion besteht in erster Linie darin, die vielen unbewusst getroffenen Planungsentscheidungen bewusst zu machen und sie in einen logischen
Begründungszusammenhang zu stellen. Die schriftliche Fixierung ermöglicht es dabei, die Planungsentscheidungen anschließend im Hinblick auf das konkrete
Unterrichtsgeschehen kritisch zu reflektieren und dabei ggf. Schwachstellen ebenso aber auch besondere Stärken ausfindig zu machen und bei nachfolgenden
Planungen zu berücksichtigen. Insofern bietet sich hier die Chance zur Optimierung von (nachfolgendem) Unterricht, sodass schriftliche Unterrichtsentwürfe
als Evaluationsinstrument für den eigenen Unterricht zu betrachten sind. Schritt für Schritt entwickelt sich auf diese Weise Sicherheit im Treffen von
Planungsentscheidungen, was den hohen Arbeitsaufwand der schriftlichen Unterrichtsplanung rechtfertigt, der von Lehramtsanwärtern zuweilen als Schikane
empfunden wird.
Erst in zweiter Linie geht es bei Unterrichtsentwürfen um die Vorbereitung des konkreten Unterrichts, zumal der Aufwand nur für eine sehr begrenzte Anzahl an
Stunden realisierbar ist.
Zielsetzung des Bandes
Wie im vorigen Abschnitt erläutert, spielen Unterrichtsentwürfe schon in Praxisphasen des Studiums sowie insbesondere in der zweiten
Ausbildungsphase eine große Rolle nicht nur, weil sie entscheidend mit in die Note des zweiten Staatsexamens einfließen, sondern weil sie einen wichtigen
Beitrag zur Optimierung der eigenen Unterrichtsplanung und -durchführung leisten. Ziel des Bandes ist es vor diesem Hintergrund, den angehenden Lehrern
bei dieser neuen Anforderung zu helfen. Ein Schwerpunkt liegt dabei in der Vermittlung einer Vorstellung davon, was guten Unterricht ausmacht, durch
welche Merkmale er charakterisiert ist. Dies geschieht zum einen durch die allgemeine Beschreibung wichtiger Unterrichtsprinzipien, zum anderen aber
auch durch konkrete Unterrichtsentwürfe und Literatur- und Internethinweise, die viele praktische Anregungen geben. Zusammen schafft dies eine gute Basis
für eine Übertragung dieser Anregungen auf andere Unterrichtsinhalte, Ziele und Klassen. Darüber hinaus besteht ein zentrales Anliegen darin, den
Studierenden und Lehramtsanwärtern eine Art Handlungsanleitung für die konkrete Unterrichtplanung zu bieten, die jedoch keineswegs als
festgeschriebenes Rezept zu verstehen ist, das man Schritt für Schritt abarbeiten könnte. Denn dies würde im krassen Widerspruch zu den
Anforderungen stehen, die wir heutzutage an unsere Schüler stellen und folglich auch an uns selbst stellen sollten (vgl. Abschnitt 2.1).
Vielmehr soll der sehr komplexe Prozess der (schriftlichen) Unterrichtsplanung aufgedröselt und strukturiert werden, und es soll Transparenz
bezüglich der Anforderungen geschaffen werden. Ziel der Ausführungen ist es, bei der Strukturierung der eigenen Unterrichtsideen und Gedanken
zu helfen, wobei jedoch bewusst viele Lösungsmöglichkeiten denkbar sind, die genügend Freiraum für die eigene Kreativität lassen.
Aufbau des Bandes
Nach den einführenden Erläuterungen im ersten Kapitel soll im zweiten Kapitel in Anlehnung an die neuen Bildungsstandards (2004) und die hierauf
basierenden Lehrpläne eine Idealvorstellung des Mathematikunterrichts (bzw. häufig auch des Unterrichts allgemein) in der heutigen Zeit vermittelt
werden. Dabei wird aufgezeigt, welche allgemeinen Grundsätze er erfüllen soll und welche Erwartungen bzw. Anforderungen an Lehrer und Schüler hiermit
verbunden sind. Zentral auf Schülerseite ist dabei die Unterscheidung in allgemeine (prozessbezogene) und inhaltsbezogene mathematische Kompetenzen,
die ausführlich dargestellt und an konkreten Beispielen erläutert werden. Es folgt im dritten Kapitel eine ausführliche Erörterung der (schriftlichen)
Unterrichtsplanung, die dabei helfen soll, die entwickelten methodischdidaktischen Ideen unter Berücksichtigung aller relevanten Einflussfaktoren des
Unterrichts sinnvoll in die Praxis umzusetzen. Zu diesem Zweck erfolgt zunächst eine theoretische Darstellung allgemeiner Grundlagen der Unterrichtsplanung,
in der wichtige Strukturen und Beziehungen des Unterrichts offen gelegt werden und ein erster Einblick in die zahlreichen Aspekte vermittelt werden soll,
die bei der Unterrichtsplanung zu berücksichtigen sind. Diese werden bei den Ausführungen zu den Inhalten und Anforderungen an schriftliche
Unterrichtsentwürfe weiter konkretisiert und strukturiert, wobei zusätzlich praktische Hinweise zur Verschriftlichung gegeben werden. Nach diesen
theoretischen Grundlagen bezüglich der Anforderungen an den Mathematikunterricht sowie an die Gestaltung und Verschriftlichung eigener Unterrichtsstunden
bzw. -besuche werden im vierten Kapitel exemplarisch 18 gut gelungene Unterrichtsentwürfe dargestellt. Es handelt sich um authentische Entwürfe, die
sorgfältig durch Experten aus verschiedenen Studienseminaren (Bielefeld, Minden, Marburg) bzw. aus dem Fachpraktikum (Schwäbisch Gmünd) ausgewählt und
für diesen Band weiter optimiert wurden (vgl. Abschnitt 4.1). Sie veranschaulichen exemplarisch gut reflektierte Umsetzungsmöglichkeiten didaktischer
Grundideen unter Berücksichtigung der Gesamtkomplexität des Unterrichts. Sie sollen den Leser für wichtige Planungsüberlegungen und entscheidungen
sensibilisieren mit dem Ziel der Übertragung auf eigene Unterrichtsplanungen. Ferner bieten die Beispiele vielfältige Übertragungsmöglichkeiten auf
andere Klassenstufen, andere Inhalte und Ziele. Denn neben der guten Qualität als selbstverständlich grundlegendem Auswahlkriterium wurden die Entwürfe
bewusst so ausgewählt, dass sie ein möglichst breites Spektrum des Mathematikunterrichts in der Grundschule abdecken. So werden nicht nur alle
Jahrgangsstufen der Grundschule berücksichtigt, sondern in jeder Jahrgangsstufe werden nahezu alle mathematischen Grundideen und viele allgemeine
mathematische Kompetenzen angesprochen.
Der Band schließt mit einigen Internet- und Literaturhinweisen, die sowohl inhaltlich als auch methodisch
weitere Anregungen für die Planung und Gestaltung von Unterricht geben können.
Klicken Sie hier, um sich das gesamte Probekapitel als .pdf-Datei herunterzuladen. |